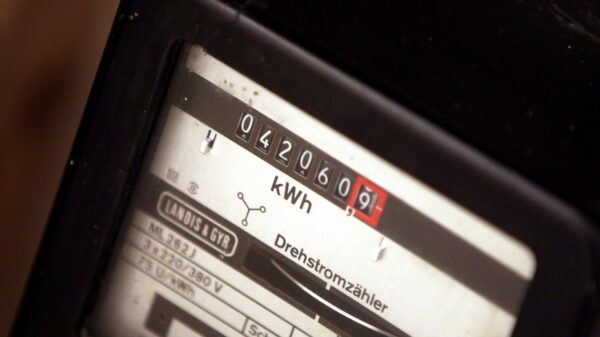Berlin (dts) – Die Corona-Pandemie hat einer neuen Studie zufolge deutlich größere Auswirkungen auf die psychische Gesundheit junger Menschen gehabt als die weltweite Finanzkrise zwischen 2008 und 2010. Das geht aus einer neuen Veröffentlichung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervor, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben) vorab berichten.
Demnach haben sich jüngere Menschen offenbar wesentlich schlechter von Kontaktbeschränkungen, Homeschooling oder Ausgangssperren während der Krisenjahre erholt. Der Studie zufolge wiesen die unter 50-Jährigen 2022 sogar erstmals eine niedrigere psychische Gesundheit auf als ältere Menschen.
Anders nach der weltweiten Finanzkrise: Auch damals, so die Forscher, seien alle Altersgruppen betroffen gewesen. Die psychische Erholung allerdings habe hingegen über alle Generationen hinweg gleichermaßen stattgefunden. Nach Corona hingegen habe die Verschlechterung der psychischen Gesundheit insbesondere jüngere Menschen bis einschließlich 49 Jahren betroffen, „je jünger, desto stärker“, so die Autoren in der Studie.
Bei den mindestens 50-Jährigen hingegen lag die psychische Gesundheit im Jahr 2022 bereits wieder beinahe auf dem Niveau vor der Pandemie. Den Unterschied in der Entwicklung erklären sich die Forscher auch mit anhaltenden Gedanken, die sich vor allem die Jüngeren machten.
„Die Krisen, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine, und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Konsequenzen und Unsicherheiten können dazu führen, dass Menschen im Erwerbsalter vermehrt vielfältigen Sorgen ausgesetzt sind“, sagte DIW-Gesundheitsökonom Daniel Graeber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Graeber fordert, das Thema psychische Gesundheit ernst zu nehmen – das betrifft auch das berufliche Umfeld. Gerade angesichts eines zunehmenden Fachkräftemangels werde es perspektivisch darum gehen, Beschäftigte möglichst lange arbeitsfähig zu halten, sagte Graeber weiter. Prävention und Therapie psychischer Erkrankungen sollte daher im beruflichen Kontext an Bedeutung gewinnen.
Für Betroffene sollte es in Krisensituationen niedrigschwellige Angebote geben, die ihnen Unterstützung bieten, ohne den teilweise langwierigen Prozess hin zu einem Therapieplatz zu absolvieren. „Außerdem ist es wichtig, psychische Erkrankungen endlich zu entstigmatisieren und den Betroffenen nicht zu unterstellen, sie würden nicht arbeiten wollen“, so der DIW-Wissenschaftler.
Psychische Erkrankungen nehmen in Deutschland generell wieder zu. Einem Bericht der DAK-Krankenkasse zu Folge lag die Anzahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen im Jahr 2023 je 100 Arbeitnehmer bei 323. Gegenüber dem Jahr 2013 war das ein Anstieg um 52 Prozent.
Grundsätzlich war hierzulande zuletzt auch über die gestiegenen Krankheitstage insgesamt diskutiert worden. Spekuliert wurde auch, ob die während der Pandemie erstmals eingeführte telefonische Krankschreibung „Blaumachen“ begünstige. Die neue DIW-Erhebung sieht diesen Zusammenhang zumindest für psychische Erkrankungen nicht.
„In der vorliegenden Studie soll ein Perspektivwechsel vorgenommen werden und die psychische Gesundheit der Menschen in Deutschland als ein potenzieller Faktor für den hohen Krankenstand analysiert werden“, hieß es stattdessen. Maßgeblich für die neue Auswertung sind aktuelle Daten aus dem sogenannten Sozio-oekonomischen Panel, in dem seit 1984 regelmäßig in Deutschland lebenden Menschen zu ihrer aktuellen Lebenssituation befragt werden.
Foto: Junge Mädchen auf einer Rolltreppe (Archiv), via dts Nachrichtenagentur